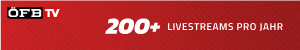Das Ernst-Happel-Stadion als würdiger WFV-Cupfinal-Standort der Männer
Am 8. Mai begegnen sich um 19.00 Uhr bei freiem Eintritt Dinamo Helfort und die SV Donau im „Sport Riss“-Wiener Landescupfinale im Ernst-Happel-Stadion. Es gibt in Österreich und auch europaweit kaum mehr Stadien, die so viel Zeitgeschichte verkörpern wie das alt-ehrwürdige Ernst-Happel-Stadion. In guten Momenten dient es als stimmungsvoller Ort des Sports oder auch von Konzerten, in stillen Phasen stellen sich jährlich die Diskussionen um seinen Fortbestand ein. Aber es wird weiter genutzt - nicht nur in Sachen Büroräumlichkeiten des Wiener Fußball-Verbands, sondern eben auch für das WFV-Cup-Finale der Männer am 8. Mai um 19.00 Uhr. Günther Bitschnau beleuchtet die Geschichte der Traditionsstätte des Wiener Fußballs.
Im Schnitt einmal im Jahr kommt sie auf, die Diskussion um die Zukunft des Ernst-Happel-Stadions: Umbau oder Neubau? Wie soll es weitergehen? Die Frage nach der langfristigen Nutzung ist berechtigt, kurzfristig aber bleibt der riesige Bau beim Prater jedenfalls eines der optisch eindrucksvollsten Wahrzeichen Wiens und darüber hinaus ein Ort der Begegnung für die Massen. Diese strömen gleichermaßen zu den Länderspielen des Österreichischen Nationalteams wie zu Konzerten internationaler Top-Stars. An ruhigen Tagen aber, da ist das Happel-Oval vor allem Anlaufstelle und Heimat für viele Verbände und Organisationen - wie auch die Geschäftsstelle des Wiener Fußball-Verbands.
Das Nationalstadion unseres Landes, das der Stadt Wien gehört, hat seine Ursprünge 1915. In der Hauptstadt sollte ein Zentralstadion, das möglichst viel Sport, aber auch andere Tätigkeiten in sich vereinen sollte, gebaut werden. Der 1. Weltkrieg machte den visionären Plänen zwar ein vorläufiges Ende, aber die Idee sollte auch die schweren Zeiten überdauern. Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der neuen Republik Österreich beschloss man den Bau der Stadionanlage. Beim dafür ausgeschriebenen Wettbewerb konnten Interessierte ihre Überlegungen einreichen – die vom Fußball über Schwimmen, Fahrradfahren, Tennis oder Hockey reichen sollten. Im November 1928 erfolgte schließlich die Grundsteinlegung für ein Projekt der Sonderklasse: Ein multifunktionales Sportzentrum sollte es werden, eine Heimat für möglichst viele Sportarten und den dazugehörigen Rahmenbedingungen. Bei der Arena waren somit auch Trainingsplätze, Turnhallen, ein Radrennbahn und Badeanlage inkludiert. In nicht einmal zwei Jahren wurde das Oval gebaut und am 11. Juli 1931 erfolgte die Eröffnung - damit einher ging übrigens auch die Inbetriebnahme des bis heute populären Stadionbads.
Den vermeintlich ruhigen Jahren folgte aber die dunkelste Stunde: Der 2. Weltkrieg brach herein und das „Praterstadion“ wurde vom NS-Regime zweckentfremdet: Zahlreiche Wiener Juden wurden hier inhaftiert und später ins KZ deportiert, während man tags darauf wieder den Ball rollen ließ. Bombenangriffe der Alliierten zogen das Stadion schwer in Mitleidenschaft, In der Nachkriegszeit wurde es wieder in seinen früheren Zustand aufgebaut, auch als Symbol des neuen, freien Österreichs. Es ging bergauf mit dem Land, der Wirtschaft und damit auch dem Sport: Das Praterstadion wurde 1959 auf bis zu 90.000 Plätze (!) erweitert und war somit damals in seiner Bauweise auch eines der größten weltweit. Den Zuschauerrekord markierten 90.726 Fans am 30. Oktober 1960 beim Duell Österreichs mit Spanien (3:0). Fünf Jahre später wurde das Praterstadion aber wieder rückgebaut.
Das populäre Oval begeisterte fortan die Massen - bei Länderspielen ebenso wie bei internationalen Aufeinandertreffen im Europacup. Die erste große Änderung - namentlicher Natur - erfolgte Anfang der Neunziger, als man das Praterstadion zu Ehren des großen Spielers und Trainers Österreichs in „Ernst-Happel-Stadion“ umbenannte. Die zweite folgte im Zuge der Fußball-Europameisterschaft 2008, als man den Austragungsort renovierte, umbaute und so gut es ging, auf modernen Stand brachte - immer mit Bedacht, dass Bereiche, wie das Dach des Stadions, denkmalgeschützt sind. Vereinen wie dem SK Rapid oder FK Austria diente es später als Heimstätte zwischendurch, als man das jeweilige eigene Stadion neu- bzw. umbaute.
Wenn also nicht gerade eine große Mannschaft ihre Heimspiele im Happel-Stadion austrägt, dann tun das kleinere Vereine, um Großes zu schaffen: Das heurige Finale im WFV-Cup der Männer hat einen würdigen Austragungsort, dessen Geschichte spürbar bleibt.