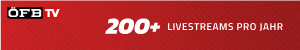WFV Interview mit Sara Telek, Teil 1
Die Wienerin Sara Telek ist wohl Österreich Parade- und Vorzeige-Schiedsrichterin. Im WFV-Exklusiv-Interview mit Günther Bitschnau erzählt sie über ihren Werdegang, ihren Premiere-Auftritt und über den Umgang mit Selbstkritik. Hier ist Teil 1 des Gesprächs.
WFV: Sara, wenn man sich in Österreich mit Fußball beschäftigt oder ihn verfolgt, dann hat man dich schon einmal gesehen. Als Frau in der Männerdomäne fällt man grundsätzlich auf, im Schiedsrichterwesen nochmal besonders. Wie hat alles begonnen?
Sara Telek: Ich habe relativ spät, mit 14 Jahren, zum Kicken angefangen. Im Zuge dessen wurde ich mit 19 Jahren zufällig auf die ÖFB-Kampagne „Karriere mit Pfiff“ aufmerksam. Ich dachte mir, es schadet nicht, die Fußballregeln im Detail zu erlernen. Da ich bis dahin hauptsächlich Street Soccer im Park und Käfig gespielt habe, war ich nicht mit allen Spielregeln vertraut. Umso mehr Anlass und Motivation, die Ausbildung zu probieren: Der Schiri-Kurs dauerte damals mehrere Wochen. Gemeinsam mit meinen Kollegen fieberten wir auf unser erstes Spiel hin. Die Herausforderung hat uns verbunden, die Gemeinschaft war sicherlich auch ein Grund, weshalb ich dabeigeblieben bin.
Aber dann gab es gleich mal einen Rückschlag…
Ja, kurz vor meinem Debüt als Schiedsrichterin hatte ich mich bei einem Freundschaftsspiel verletzt und war ein halbes Jahr außer Gefecht – trotz so langer Pause zu Beginn bin ich dennoch dabeigeblieben. Nach der Verletzungsunterbrechung konnte ich endlich erste Erfahrungen in meinem Debut sammeln: Ein Nachwuchsspiel am Sportclub-Platz, komplett auf mich alleine gestellt, wurde mir dort die Verantwortung und Funktion als Spielleiterin erst so richtig bewusst.
Wann hat es bei dir „Klick“ gemacht, gab es einen Schlüsselmoment?
Noch lange nicht. Nach der Matura machte ich ein Jahr Sabbatical und habe anschließend den Kurs absolviert. Parallel dazu begann ich zu studieren. Nach meiner Verletzung verbrachte ich ein Erasmus-Jahr in Ungarn. Zu dem Zeitpunkt war ich mir der möglichen Chancen noch nicht bewusst. Ich habe das Hobby aus Interesse weiterverfolgt, da es Spaß machte, zugleich spannend und herausfordernd war. Zudem war ich dadurch sportlich aktiv und konnte mir als Studentin etwas dazuverdienen. Ganz in der Anfangsphase, wo mir viele Abläufe und Strukturen unklar waren, wusste ich auch einfach gar nicht, wie man sich da wieder abmeldet (lacht), da ja jede Woche automatisch die Spiel-Ansetzung via SMS fürs nächste Wochenende kam, fühlte ich mich einfach verpflichtet dorthin zu gehen. So richtig Klick hat es erst nach einigen Jahren, 2016, gemacht, als mir erst so richtig bewusst wurde, welche sportlichen Ziele ich verfolgen und erreichen könnte. Da erwachte der Ehrgeiz in mir.
Du warst nebenbei auch journalistisch bei Fußballspielen tätig und hast auch entsprechend dazu studiert. Hat dir das später geholfen, um als Schiedsrichterin mit Öffentlichkeiten umgehen zu können?
Das hilft natürlich. An der Uni habe ich mir theoretisches Wissen über PR, Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation angeeignet. Durch diverse berufliche Praxis im Medienbereich sammelte ich anschließend journalistische Erfahrung und lernte den Fußballsport aus einer neuen Perspektive kennen. Ich hatte aber grundsätzlich auch keine Scheu, mit Leuten in Kontakt zu treten oder auf einer Bühne vor Publikum zu stehen. Das Schiedsrichtern wird oft mit der Schauspielkunst verglichen, denn du stehst ebenfalls im Fokus, bist in deiner Rolle präsent, und musst deine Entscheidungen glaubhaft verkaufen. Eine introvertierte Person tut sich in dieser Rolle sicherlich schwerer als eine extrovertierte Persönlichkeit. Im Schiedsrichterwesen wird insgesamt in Sachen Persönlichkeit noch wenig gearbeitet. Theorie und Fitness werden stets gefordert und forciert, jedoch bei der Persönlichkeitsentwicklung gibt es kaum Fortbildungsmöglichkeiten, obwohl hier so viel Potential schlummert. Jene, die hier schon Erfahrung haben, geschickt und selbstbewusster sind, tun sich leichter im Vergleich zu jenen, die sich erst anlernen müssen, ihre Körpersprache, ihr Auftreten, ihre Ausstrahlung, Gestik und Mimik wirksam zu nutzen. Diese Entwicklung hat auch viel mit Selbstwahrnehmung und Selbstreflexion zu tun.
Und wie hast du deinen ersten Einsatz selbst wahrgenommen, als Frau im Männerfußball?
Es gab ja bereits vor mir Schiedsrichterinnen im Wiener Fußball-Verband, wie zum Beispiel Christine Bango oder Claudia Obermüller, die zu ganz anderen Zeiten anfingen und den Weg ebneten. Dennoch war es bei mir für viele wieder ein Novum, da im Laufe der Zeit natürlich auch die Generationen und Menschen im Verein wechseln. Da es nicht die breite Masse an Schiedsrichterinnen gibt, wird es nach wie vor als außergewöhnlich angesehen. Wenn ich heute in der Stadtliga pfeife, fällt es dem Publikum nach wie vor auf, als letztens wieder ein Junge rief: „Da pfeift ja eine Schiedsrichterin!“ Ich selbst hatte keine Idole oder Vorbilder in dem Bereich, da mir davor die Rolle der Schiedsrichterin einfach nicht präsent war. Selbst als aktive Spielerin nahm ich den Unparteiischen erst so richtig wahr, als ich einen Elfmeter zugesprochen bekam.
Welche weiteren wichtigen Erkenntnisse profitierst du heute noch?
Für mich das Wichtigste: Sich durchzusetzen und es anderen nicht recht machen zu wollen, sondern der eigenen Wahrnehmung und Entscheidung zu vertrauen. In unserer Gesellschaft lernt und versucht man von klein auf, allen - Lehrer:innen, Eltern oder Freund:innen - zu entsprechen, um akzeptiert zu werden. In der Rolle als Schiedsrichter:in merkst du schnell: Das funktioniert nicht. Du kannst dieses früh verinnerlichte Ziel, möglichst allen zu entsprechen, nicht erfüllen. Schnell lernt man, nur sich selbst zu entsprechen. Ich muss am Ende des Tages mit meiner Leistung zufrieden sein und mir selbst in den Spiegel schauen können. Da ist es irrelevant, ob sich andere fürchterlich aufregen, ich aber für mich weiß, die Entscheidung hat gepasst.
Bist du ein selbstkritischer Mensch? Schaust du dir deine Spiele nochmal an?
Ja, ich bin sehr selbstkritisch, da ich bestrebt bin, mich stets zu steigern und zu verbessern. Es gibt kein Spiel, wo alles passt. Es sind oft Kleinigkeiten, die den Zuschauer:innen gar nicht auffallen, wie Positionierungen, Teamwork, Spielmanagement. Bei einer Fehlentscheidung ist es relevant, danach zu analysieren, wie es überhaupt zu der Fehlwahrnehmung kommen konnte, um beim nächsten Mal besser zu agieren. Man muss sich selbst kritisch einschätzen können und stets hinterfragen, um sich weiterzuentwickeln.
Fotocredits OEFB